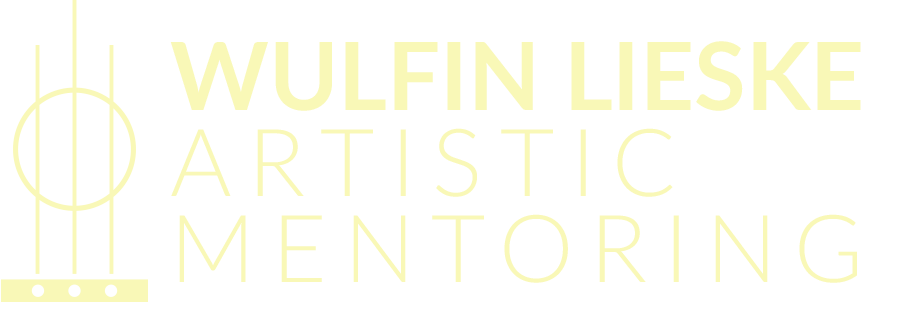Warum Gitarre?
Der Eierschneider klang eigentlich garnicht so schlecht… Ich war gerade mal zehn Jahre alt. Immer wenn es zum Frühstück gekochte Eier gab spielte sich folgende Szene ab: bevor das Ei seinen Weg zu den metallenen Saiten des „Schneidboy“ fand, versank ich vollkommen in den irrational zirpenden Harfenklängen dieser ultimativen Erfindung der 70er Jahre. Das Ei wurde unterdessen kalt und zu Weihnachten bekam ich meine erste Gitarre namens „Klira“. Die klang auch so. Aber ich hatte keinen Vergleich und war happy. Dass ich zwei Jahrzehnte später einmal die berühmteste Gitarre der Welt, die legendäre „La Leona“ aus dem Jahre 1856 von Antonio de Torres spielen würde, war mir damals noch nicht klar.
Ich wurde in ein musikalisches Elternhaus in Linz an der Donau geboren: meine Mutter sang und mein Vater war Solocellist an der Stuttgarter Staatsoper. Aber klar, ich wollte es anders und der Weg führte zur Gitarre. Die klassische Gitarre hörte ich erstmalig auf einer LP von John Williams, bei dem ich dann später in Córdoba Unterricht hatte. Dem stand aber auch ziemlich schnell Jimi Hendrix gegenüber. Das führte dann bald zu meiner ersten E-Gitarre, eine sehr schöne Gibson SG Standard in cherry red und dann natürlich zu den ersten Bands. Von Fusion ging es bis zum Free Jazz Quartett EXTEMPORE. Aber das war schon im Studium.
Mein erstes Konzert spielte ich in der wunderbaren Akustik der berühmten Abbey auf der schottischen Insel Iona - Bach, Villa-Lobos und Improvisationen. Noch vor dem Abitur hatte ich als Jungstudent schon Unterricht bei meinem zukünftigen Hochschul-Professor. Dabei musste ich mich noch zwischen Musik und Astronomie entscheiden: ich habe dann doch die Musik gewählt, da mir die kommunizierte Emotion menschlich wichtiger erschien.

Das erste Mal die Magie gespürt

Mitte der 80er Jahre kam mein Freund, Kunsthistoriker und Gitarren-Sammler Dr. Michael Herrmann zu mir nach Köln und zeigte mir seine Torres-Gitarre von 1888. Ich spielte anschliessend am Küchentisch bis in die tiefe Nacht mein ganzes Repertoire auf dieser traumhaften Gitarre.
Ich war wie auf einem Trip und für mich war klar: das ist mein Weg. Bei Torres vollzieht sich eine Transformation vom Instrument hin zur Musik, vom Holz zum Klang. Und das in einer nie gehörten Weise - sie führt uns in eine Transzendenz.
Gerade bei der Musik von Bach wurde dies fundamental spürbar. In dem Klangkonzept von Torres offenbart sich eine geistige Kraft, die unmittelbar mit seiner Musik verschmilzt. Durch die tiefe Abstimmung verbindet sich mein Körper mit dem Klang, ich bin eins mit dem Instrument und die Grenze zwischen Subjekt und Objekt verschwimmt. Es ist, als ob der ganze Körper das Instrument anschlägt, zum Schwingen bringt und nicht nur die Finger. Mit dieser Gitarre habe ich 1991 für EMI Classics die Alben „Guitarra Español“ und „Albéniz“ gemacht, die weltweit ersten Torres-Aufnahmen überhaupt.
Künstlerisches Machtgefühl
1978 spielte ich mit meinem Free Jazz Quartett EXTEMPORE beim 1. Jazzhaus-Festival vor grossem Publikum in Köln. Ich spielte dann auf einmal ganz alleine mit meiner E-Gitarre, improvisierte mit voller Power ein 12-minütiges Solo, ohne Noten, ohne Plan. „Ich war total eins mit mir, spürte, wie sich jeder einzelne Ton in die Zuhörer meisselte. Aber ich musste keine Erwartung erfüllen, wie in der Klassik, wo es heisst: hier sind die Noten. Es gab kein richtig oder falsch sondern nur 100% oder nichts.“ Dies gab mir ungeheure Freiheit und Freude, aber auch ein enormes Machtgefühl in der Interaktion mit meinem Publikum.
Ich spürte, wie gebannt alle zuhörten. Und dieses Spielgefühl, die musikalischen Urkräfte, habe ich mit in die Klassik hineingenommen. Also von Free Jazz auf der Gibson zu Bach auf der Torres. Klingt unmöglich, ist aber wahr. Das war das Schlüsselerlebnis: unmittelbares Feed-Back und kein Stress. Heute spiele ich zwar keine E-Gitarre mehr, aber das Gefühl ist wie damals „im Flow“.

Der Absturz

Zum Ende meines Studiums passierte es mir: mitten in einer Bach-Partita hatte ich einen richtigen Blackout. Der wunderschöne Saal in Brühl war ausverkauft, die Presse war da, auch mein Verleger. Der Druck war also gross und plötzlich, mitten in der schier endlosen Fuge, wusste ich einfach nicht mehr weiter.
Ich musste von der Bühne, sah nur noch grau und spürte mich selbst nicht mehr. Ein Wunder, dass mein Herz noch schlug. Aber ich baute mich wieder auf, trat vor mein aufgeregt tuschelndes Publikum, liess den Bach Bach sein und setze mein Programm mit Giuliani fort.
Wie konnte dies passieren, und warum? Es lag nicht an der Vorbereitung, ich hatte das lange Werk schon oft gespielt und damit einige Wettbewerbe gewonnen. Nein, es war Angst. Angst, zu versagen, die Erwartungen nicht zu erfüllen: „Jetzt darf nichts passieren!“ Und dann verselbstständigen sich die Gedanken. Und es passiert eben doch. Die Psyche hält den Stress nicht mehr aus.
Ich habe dann auch mehrere Jahre keinen Bach mehr gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn für mein Ego, meine Selbstdarstellung missbraucht hatte. Und nun rächte er sich.
Von der Angst zur Musik
Dafür verwende ich heute eine Methode, die ich auch an meine Klienten weitergebe. Wir lösen uns von der Angst, vor dem Gegenüber zu versagen, indem wir immer unmittelbar mit der emotionalen Kraft und Aussage der Musik verbunden und indem wir auch die im Übe-Prozess entspannt, aber konzentriert und zugleich stressfrei bleiben. Wir können auch zunächst nur für uns selbst spielen. Und vor uns selbst müssen wir uns eigentlich nicht fürchten, oder?
Dann wissen wir, dass wir im Dienst an der Musik unser Bestes an Vorbereitung gegeben habe und können nun mutig und mit Freude auf die Bühne gehen.
Dazu kommen meine zwei Kernsätze, quasi Leitmotive:
- spiele nur Stücke, die dich absolut begeistern und herausfordern, nur so hast du die Energie in die Einstudierung zu investieren.
- spiele nur Stücke, die dich von der Schwierigkeit durchaus fordern aber nicht überfordern, denn du willst sie in einem angemessenen Zeitraum perfekt spielen können.
Was mir letztlich die Angst genommen hat, ist die Liebe zur Musik.

Warum ich Ihnen das alles erzähle?

Dies ist der Spiegel meines eigenen Weges. Mich treibt letztlich immer die künstlerische Botschaft an, das eigentlich Unsagbare.
So arbeite ich auch als Komponist oder als Arrangeur. Wenn ich die d-moll Partita mit der Chaconne spiele, möchte ich Bachs Geist mindestens so nahe kommen wie der Geiger seinem Original. Es geht um die innewohnende Idee, um das Absolute und wie sich dies in der natürlichsten Weise auf der Gitarre darstellen lässt. Das geht natürlich nicht mit jedem Werk aber mit der sehr, sehr vielen.
Arbeite ich an einem neuen sinfonischen Werk profitiere ich im Umgang mit Klangfarben. Umgekehrt hilft mir die Komposition bei der unmittelbaren Umsetzung von Interpretationen anderer Werke. So kann ich zum Beispiel Pianisten neue Sichtweisen auf Chopin vermitteln und inspiriere sie zu einem tieferen Verständnis seiner Partituren.
In fortwährendem Prozess der Selbstoptimierung und der jahrelangen Unterstützung von zahllosen Klienten bin ich heute in der Lage jeden, der es wirklich erfahren und umsetzen will, sehr klar und direkt auf die wesentlichen Schritte zu lenken. Das ist der Weg zum eigentlichen Ziel: besser und erfüllter mit der Gitarre grossartige Musik zu spielen.